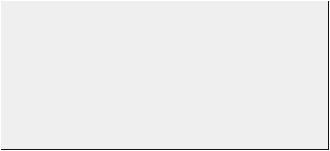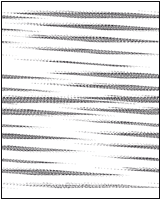Johann Christoph Adelung zum 200. Todestag
(10. September 2006)
(gf) Der Titel ãUmstndliches Lehr- gebude der
Deutschen Sprache zur Er- luterung
der
Deutschen Sprachlehre fr SchulenÒ hat sicherlich bei jedem Germanistikstudenten der
jngeren Zeit unwillkrlich Schmunzeln hervorgeru-
fen. Schuld an der Belustigung ist aber nicht Adelungs Titelwahl, sondern der Sprachwandel:
umstndlich bedeute- te frher ãausfhrlich (viele
Umstnde einbeziehend) ã, und ãumstndlichÒ in
diesem Sinne ist das Werk wahrhaftig,
denn der erste Band umfa§t
884 und der zweite 798 Seiten, es hat also ins- gesamt 1682 Seiten. Genauso seltsam
klingt in unserem Ohren der Name des
Werkes, das fr uns Sprachpfleger wohl noch gr§ere Bedeutung besitzt als das
ãUmstndliche
LehrgebudeÒ, nmlich das ãGrammatisch-kritische Wrterbuch der hochdeutschen MundartÒ. Das Hoch- deutsche eine
Mundart zu nennen ist uns
fremd geworden. Das Wrterbuch
ist zwar nicht ohne Vorlufer (z. B. K. Stie- ler), aber das erste seiner
Art und von un- schtzbarer Bedeutung fr die Sprachge- schichtsforschung. Es war zu seiner Zeit vorbildlich, auch Goethe bentzte
es (und wrdigte den Sprachforscher sogar eines
Besuches). Da§ Adelung ein bedeutender Mann war, zeigt allein die Tatsache, da§
seine ãDeutsche SprachlehreÒ 1782 fr die Schulen in
sterreich als
vorbildlich vorgeschrieben wurde -und
das trotz der Vorbehalte der Oberdeutschen gegen das von Adelung als
nachahmenswert vorge- schlagene Mitteldeutsch. Sein Stilbuch ist bedeutsam
(ãber den deutschen StylÒ, 1785), es
war das erste gro§e Werk ber
deutsche Stilistik.
Warum ist Adelung heute nicht so
bekannt wie andere Sprachforscher? (In der ,,DDRÒ war
er brigens angesehener
als
in der BRD, wohl weil sich die Kom- munisten in
Verkennung der Tatsachen als Nachfolger der deutschen Aufklrer vorkamen.) Er stand zwischen
den Zeiten. Er gehrte
zu den Aufklrern,
er war kein Rationalist, sondern die ãSinnlichkeitÒ ist
die Grundlage seiner Forschungen, er war
also Sensualist; er meinte, da§ alle Er- kenntnis aus den Empfindungen stamme.
Er war jedoch zu spt geboren,
um fr die Aufklrung
noch erfindungsreich zu sein
und war andererseits noch kein Teil der
Romantiker. Diese, beispielsweise E. T.
A.
Hoffmann, machten sich ber den ver-
zopften Aufklrer lustig, und so ist sein Ruhm bald geschwunden. Die berhmten Sprachwissenschafter, wie Jacob Grimm und Wilhelm von Humboldt, bauten aber
stillschweigend auf den Voraussetzungen auf, die er in beharrlichem Flei§
geschaf- fen hatte. Seine Arbeitsamkeit ist in der Tat beachtlich. Er sa§ tglich bis zu vier-
zehn
Stunden an seinem Schreibtisch und
gab mehr als hundert Schriften heraus.
Selbst in seinem Todesjahr arbeitete
er noch an einem gewaltigen Vorhaben,
dem
,,MithridatesÒ,
in dem er das Vaterunser in fnf hundert
Sprachen herausgab und Sprachvergleiche anstellte (als Etymolo- gen knnen wir ihn allerdings leider nicht
ernst nehmen. Da die indogermanistische Sprachvergleichung
erst im 19. Jh. auf- kam [auch darin war er benachteiligt], ist seine
etymologische Arbeit vorwissen- schaftlich).
Geboren wurde er in Spantekow bei
Anklam in Pommern am
8. 8. 1732, er
starb
am 10. 9. 1806 in Dresden. Von sei- nem Leben ist wenig bekannt. Er verdingte sich durch
die Arbeit als Bibliothekar und die Mitarbeit und Herausgabe von Zeit- schriften und verfa§te grammatische und
kulturgeschichtliche Werke aller Art in aufklrerischem Geist
(darunter auch eine Geschichte der Germanen; da§ er sie als
ãWildeÒ bezeichnete, nahmen ihm die Ro-
mantiker bel), aber auch Schriften ber
Metallurgie, Mineralogie und Schiffarten. Wichtig fr
uns Sprachpfleger ist, da§ er fr die
Einheit der Schriftsprache eintrat (dem dient
sein ãVersuch eines vollstndi- gen grammatisch-kritischen Wrterbuchs
 der hochdeutschen MundartÒ in fnf Bn-
den, 1774-1786), auf dem oberschsischen
Sprachgebrauch aufbauend.
der hochdeutschen MundartÒ in fnf Bn-
den, 1774-1786), auf dem oberschsischen
Sprachgebrauch aufbauend.
Das Wort Sprachgebrauch ist
ber- haupt ein wesentlicher Begriff fr seine Arbeit. Zwar wollte er in seinem
Wrter- buch die deutsche Sprache nicht nur be- schreiben, sondern auch
verfeinern, und nimmt
daher Wrter ,,pbelhaften Ge-
brauchsÒ
nicht oder nur ausnahmsweise auf (ihm ist die Sprache der gehobenen Schichten
lieber), aber als grndlicher Mensch hat er dennoch
fast den gesamten deutschen Wortschatz behandelt.
Er teilte die Wrter in fnf Gruppen ein, nach ih- rer ãWrdeÒ (wir wrden heute Stilebene sagen). Im Gegensatz zu Klopstock, der eine phonetische Rechtschreibung auf der Grundlage der Aussprache norddeutscher
Schauspieler wollte, geht Adelung vom Sprachgebrauch (hier knnte man auch von
Schreibgebrauch sprechen) aus und nimmt die
ostmitteldeutsche Aussprache als Grundlage. Er
wollte also nicht wie Klopstock eine einschneidende Recht- schreibreform,
sondern eine Festigung, auf dem Bestehenden aufbauend.
Die Geschichte hat ihm recht gegeben.
In seinem Buch ãVollstndige An- weisung zur deutschen
OrthographieÒ schreibt Adelung dazu: Ò[Orthographie wie Sprache sind im Volk
verwurzelt] Daher strubet sich jedes Volk
von Natur so sehr gegen blo§ willkrliche Vernde- rungen in der Sprache ...Ò. Dazu bemerkt Walter Dengler, der eines
der wenigen Bcher ber Adelung geschrieben hat (s. u.) auf S. 243, Fu§n. 1075: ãEs sei erinnert
an die jngst im deutschen Sprachgebiet
durchgefhrte Orthographiereform und das
Mi§trauen, welches derselben fak- tisch, in der Bevlkerung, wie bei einigen ma§geblichen Schriftstellern, begegnete.Ò 1901 entschieden sich die Rechtschreibre- former und
-vereinheitlicher fr die Ade-
lungsche Regelung der Schreibung von §und ss (also § an der Wort-und Silben-
grenze, auch wenn es nach kurzen Selbst-
lauten steht, z. B. in m§te und Mi§stand);
die jetzige Rechtschreibreform ist jedoch zur
Heyseschen Regel zurckgeschritten (msste,
Missstand).
Da der Sprachgebrauch ihm
so wich- tig war, wandte
er sich auch im Gegensatz zu Campe, den er bekmpft, nicht gegen die Fremdwrter und versuchte
nicht, sie zu verdeutschen; deswegen
haben sich auch die Sprachpfleger nie so recht fr ihn erwrmen knnen.
Er findet lateini- sche und altgriechische Wrter sehr ge- eignet fr die Bildung wissenschaftlicher
Ausdrcke, weil deren Bedeutung schon dunkel geworden
ist. Mit dieser Auffas- sung werden wir uns schwerlich
anfreun- den knnen, weil wir fr durchsichtige,
durchschaubare Wrter eintreten! Er wen- det sich
gegen Neuwrter, und zwar die, welche seit Lessing
vor allem von geniali-
schen Dichtern geschaffen wurden.
In den WSB wurde Adelungs Wr- terbuch oft angefhrt;
aufschlu§reich ist, da§ er verhltnism§ig viele
deutsche Wrter als kaum mehr gebraucht oder bereits ausgestorben bezeichnet,
die uns heute vollkommen gelufig sind.
Vgl. das Wort Beginn;
Adelung sagt dazu: ãist veraltet und
wird zuweilen nur noch von der erhabenen Schreibart im Andenken erhalten.Ò Zu abseits
schreibt Adelung: ãim Hochdeutschen
veraltetes Nebenwort des Ortes.Ò Dies ist nicht das einzige Wort,
das durch den (Fu§ball)Sport wieder zu Ehren
gekommen ist. Zu Speer sagt Adelung
1780: ãEhedem wurden auch Spie§e Speere genannt. Jetzt kommt
es in dieser Bedeutung, im
Hochdeutschen we- nig mehr vor, in dem Spie§,
Lanze u. s. w. blicher sind.Ò
Hier zeigen das deutschfreundliche
19. Jh. und die
Sprachpflege ihre Aus- wirkungen.
Viele der fast ausgestorbenen Wrter wurden von
Goethe und Schiller wiederbelebt, ein Verdienst, das heute nur Kennern bekannt ist.
Wer mit Adelungs ãWrterbuch der Hochdeutschen MundartÒ arbeiten will, dem sei die CDROM
empfohlen, die es in der ãDigitalen
BibliothekÒ, Band 40 gibt.
Wer sich nher mit Adelung beschf- tigen mchte,
dem seien folgende
Bcher, die in ihrer Bibliographie
weitere For- schungsliteratur angeben, empfohlen:
Dengler, Walter: Johann Christoph Adelungs
Sprachkonzeption.
Peter Lang: Frankfurt am Main usw. 2003 (= Europische
Hochschulschriften. Reihe I: Deutsche Sprache und Literatur. Bd. 1866)
Strohbach, Margrit: Johann Christoph Adelung. Ein Beitrag zu seinem germani-
stischen Schaffen mit einer Bibliographie seines Gesamtwerkes. Walter de Gruyter: Berlin, Neu York 1984
(= Studia Lingui- stica
Germanica 21, hg. v. Stefan Sonde- regger)
[gf
WSB 2/06 ]
Johann Christoph Adelung (1732–1806):
Sein Wrterbuch
(gf)Adelungs Wrterbuch zeigt uns den Zustand
der deutschen Sprache
in der zweiten Hlte des
18.Jh.s. und ist daher fr die Sprachpflege von unschtzbarem Werte.
Wir haben schon
letztes Mal erwhnt,
da§ Johann Christoph Adelungs Wrter- buch eine gute Quelle fr Sprachpfleger ist. In Mehls ausgezeichnetem Aufsatz
ãNeugemnztes GoldÒ
wurde gezeigt, da§ man alten deutschen
Wrtern wieder Leben einhauchen kann, indem
anhand von Adelungs Wrterbuch (und
anderen Belegen) aufgezeigt wurde, da§ Wrter, die bereits veraltet waren,
heute quickle- bendig sind. Wir knnen den Aufsatz hier nicht abdrucken, aber fr die Leser, wel- che die alten Hefte
nicht mehr besitzen, seien hier nur die Wrter aufgezhlt, fr die Adelung als
Gewhrsmann benutzt wurde (in Anfhrungszeichen
die an- gefhrte Anmerkung Adelungs):
abseits
ãim Hochdeutschen veraltetes
Nebenwort des OrtesÒ; All ãAllein
dieses Hauptwort gehret unter diejenigen, welche man mit allem Rechte hat
veralten lassen und es hat feinen Ohren
immer nicht ertrglich
klingen wollen, so sehr auch neuere Dich- ter es besonders in dem Begriffe
der Welt wieder zu Ehren zu
bringen gesucht.Ò; Barren ãein
mehrentheils veraltetes Wort, so eigentlich einen langen, aber
schma- len und dnnen Krper bedeutetÒ; Bedarf
ãein mehrentheils veraltetes Hauptwort, so nur noch in Kanzelleyen blich istÒ; Beginn ãist veraltet und wird zuweilen
nur noch von der erhabenen Schreibart im Andenken
erhaltenÒ; beginnen ãVer- altet und nur erst seit kurzem von eini- gen Neuerem ohne Noth
wieder heraus- gesucht worden, indem âanfangenÔ den Begriff ebenso gut und weit
verstndiger ausdrcktÒ (nicht aus
dem Wrterbuch, sondern aus ãUmstndliches Lehrgebude
...Ò); behagen ,,gr§tentheils veraltetÒ; Be- rater ãEin in der
guten Schreibart lngst veraltetes Wort, einen Helfer, Versorger auszudrucken,
welches bey den Dichtern des vorigen Jahrhunderts
hufig vor- kommt.Ò Brauch ãveraltet
und durch das zusammengesetzte âGebrauchÔ verdrn- get. Nur wird es noch
zuweilen von den Dichtern im Andenken erhaltenÒ; einen, einigen (Adelung
will es durch vereini- gen ersetzen);
empfnglich ãwieder b- lichÒ
(Lutherwort, das zwischenzeitlich
fast ausgestorben war);fortan ãnur
im Oberdeutschen und Niederschsischen
blich,
in der edlen Schreibart der Hoch- deutschen unbekanntÒ;
hausen ãwenig mehr gebrauchtÒ;
hehr ãvllig veraltetÒ; Heim ãein wenigstens im Hochdeut- schen vllig veraltetes HauptwortÒ; hei- misch ãim Hochdeutschen unbekannt,
im Oberdeutschen aber noch gangbarÒ; h-
fisch ãim Hochdeutschen unbekannt, im Oberdeutschen aber noch gangbarÒ; Im- bi§Ò ein nur in den gemeinen Mundarten Ober- und Niederdeutschlands
bliches WortÒ; jngst ãallgemein
bekanntÒ (war 1741 von Frisch noch
als veraltet bezeich- net worden); kreisen ãnur noch im Berg- bau und bei den Jgern.Ò; lssig ãIn dem gemeinen
Sprachgebrauche des Hoch- deutschen ist ,lssigÔ ebenso ungewhn- lich geworden
wie âla§Ô. Man braucht es noch am
hufigsten in der anstndigen Schreibart fr das hrtere
und niedrigere
âfaulÔ.Ò; lugen
ãim Hochdeutschen unbe- kannt, aber in einigen oberdeutschen
Ge- genden blich.Ò; Obmann ,,gr§tentheils
veraltetes WortÒ; Pfad ,,nur
in der edleren und hheren Schreibart gebrauchtÒ; Rie- ge ãdas hochdeutsche
âReiheÔ nach der niederdeutschen Aussprache welche in Luthers bersetzung mehrmals
(20mal nach Kluge) vorkommt, der anstndigen hochdeutschen Schreibart aber fremd ist.Ò; Rge ãein
altes, im Hochdeutschen
gr§tentheils veraltetes Wort, welches so wie alle seine
Zusammensetzungen und Ableitungen nur noch hin und wieder in den Gerichten und
in der gerichtlichen Sprachart vorkommt.Ò.
Satzung ãIm ganzen veraltet. Man braucht es nur noch
in einigen engeren Fllen.Ò; schdigen ãnur noch in dem zusammengesetzten âbeschdigenÔ ge-
brauchtÒ; solcherlei ãveraltetÒ; sphen
ãIn dem
gemeinen Sprachgebrauche der Hochdeutschen ist es veraltet, bis es in neueren Zeiten wieder von einigen in der
dichterischen Schreibart gebraucht wor- denÒ;
Speer ãEhedem wurden auch die Spie§e Speere genannt. Jetzt kommt es in
dieser Bedeutung im Hochdeutschen
wenig mehr vor, in dem Spie§,
Lanze
u.s.w. blicher
sind.Ò; staunen ãein altes deutsches
Wort, welches fr sich allein im
Hochdeutschen veraltet ist, im Ober- deutschen aber gangbar geblieben. Nach dem
Beyspiele Hallers und einiger ande- rer neuerer schweitzerischer Schriftsteller ist es auch von einigen
Hochdeutschen in die hhere Schreibart wieder eingefh- ret worden, da man es bisher in dieser Mundart [Hochdeutsch!]
nur in dem zu- sammengesetzten âErstaunenÔ kannte.Ò; vergeuden ãim Hochdeutschen veraltetÒ;
weilen ãfr sich allein veraltet, und nur in âverweilenÔ
(blich)Ò; Widersacher ãIn dem gewhnlichen Sprachgebrauche ver-
altet und ist nur noch in der Theologie und dem
Kanzelstyle so wohl von dem Teufel, als auch von den Feinden der
Christen, unter den Menschen blich, in welchen
beyden Bedeutungen es in der Deutschen Bibel hufig ist.Ò; Wonne ãman hatte das Wort im Hochdeutschen
gr§ten The- ils veralten lassen ... allein
die neueren Schriftsteller haben es ohne Noth wider in den Gang gebracht, indem es bei seinem
dunkelen Baue wenig mehr sagen kann als
Freude, dieses Wort auch noch nichts von seiner Wrde verlohren hat, da§ man es
nthig htte, es durch ein anderes zu ersetzen.Ò;
zeihen ãwenig gebruchlich, daher nur
hin und wieder in der hheren Schreibart gebraucht.Ò
Das sind aber nur einige Beispiele fr Wrter, die Adelung
als veraltet be- zeichnet, die uns heute jedoch gelufig sind. Leider sind
einige seit Abfassung des Aufsatzes (1971, Mehl benutzte da- fr ein Buch aus
dem Jahre 1933) wieder ziemlich altertmlich wie zeihen, andere wie abseits sind
u§erst lebendig, beson- ders zuzeiten von Fu§ballereignissen, andere wie lssig werden gerade durch
das Denglische verdrngt
(cool). Der Auf- satz zeigt uns jedenfalls, da§ die Spra- chentwicklung dem Willen des Menschen unterliegt. Heute haben wir die Wahl, sie selbst zu pflegen, wie die Mitglieder des Vereins
ãMutterspracheÒ es tun, oder sie von Werbefirmen und Multinationalen Konzernen entwickeln zu lassen (vgl. Coca Cola: ãltÔs your
Heimspiel.Ò). Der Aufsatz zeigt uns zudem, wie wichtig das Adelungsche Wrterbuch ist.
Woher w§- ten
wir sonst, wie die angefhrten Wr- ter in der zweiten Hlfte des achtzehnten Jahrhunderts klangen?
Adelungs Wrterbuch (ÒVersuch ei- nes vollstndigen grammatisch-kritischen Wrterbuchs der
hochdeutschen Mund- artÒ, 5 Bnde, 1774-86) ist
berhaupt bahnbrechend. Erstens gab es kaum deutsche
Wrterbcher vor seinem, und zweitens waren diejenigen, die es gab, anders aufgebaut als seines. Kaspar Stie- lers Wrterbuch
verzeichnete, das ist an- zuerkennen, den Wortschatz
seiner Zeit (ÒDer Teutschen Sprache Stammbaum
und Fortwachs oder Teutscher Sprach- schatzÒ, 1691), aber es ist nicht so benut- zerfreundlich wie das
Adelungs, weil es nicht nach dem Abc geordnet ist, sondern nach Ableitungen; so
mu§ man alle Wr-
ter mit Zug unter
Zug suchen, bei Adelung ist z.B. Verzug unter V zu finden. Sehen
wir uns den Eintrag fr Abgeschiedenheit (oben das Original,
natrlich in Fraktur) an:
Die Abgeschiedenheit, plur. inus. [die
Mehrzahl ist unblich] 1) Der Zustand
der Absonderung von einer Sache, im mora- lischen Verstande. Die
friedliche Abge- schiedenheit von der Welt, in
den Kl- stern; da denn auch
wohl ein hoher Grad der Einsamkeit mit diesem Nahmen
belegt wird. 2) Bey den
Mystikern, der Zustand der Unterdrckung aller Empfindungen und ihres Bewu§tseyns, mit einem Grie-
chischen Kunstworte, die Apathie; sonst auch die
Abgezogenheit.
Wie s§ ist doch ein
freyer Wandel, In voller Abgezogenheit, Arnold.
Die Erluterungen sehen schon sehr modern aus. Adelung
zeigt, da§ es ver- schiedene Bedeutungen gibt, erklrt die Bedeutungen, bringt uns diese durch Beispiele nahe und
zeigt uns bedeutungs- hnliche Wrter. Wenn mglich, werden Redensarten
und Sprichwrter mit dem besprochenen Wort angegeben, Verwand- te aus germanischen Sprachen genannt (beispielsweise schwedisch Aftonmal un-
ter ãAbendmahlÒ) und Beispiele aus der Literatur
angefhrt. Er bespricht auch die Angaben anderer
Sprachwissenschafter.
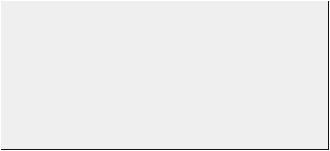 Wie gesagt, gibt es noch viele andere Eintrge
mit der Bemerkung ãveraltetÒ, die uns nicht veraltet
vorkommen, so sind
Wie gesagt, gibt es noch viele andere Eintrge
mit der Bemerkung ãveraltetÒ, die uns nicht veraltet
vorkommen, so sind
z. B. abhold (jemandem abhold
sein), Ab- kmmling, abkriegen (klingt umgangs- sprachlich, ist aber in der Wendung
er hat etwas abgekriegt ãeinen
Teil bekommen, Schaden abbekommenÒ
hufig), achtbar (Adelung: ãein Wort, welches
nur noch in den gro§en Theils auch schon
veralteten Titeln achtbar, gro§achtbar, hochachtbar, und vorachtbar gebraucht
wirdÒ) und er- kunden (Òein im Hochdeutschen
veral- tetes WortÒ) noch lebendig. Der Abort
wird heute nicht als ãabgelegener OrtÒ verstanden, sondern als
Bedrfnisanstalt. Zu dem heute
wieder beliebteren Ade teilt uns Adelung mit (das Sternchen * steht fr
ãveraltetÒ): Ò* Ade, ein aus dem franzsi- schen Dieu verderbtes Abschiedswort, fr Lebe wohl! dessen
sich die Dichter des vorigen Jahrhunderts oft zu
bedienen pflegten. Ade! Weld Ade! Gryph[iusl.
- Nun
Ade ihr Feldgttinnen, / Nun Ade du grne Lust! Opitz. Und das bekannte Lied: Welt
Ade! ich bin dein mde. Die Neuern haben zwar dieses verstmmelte
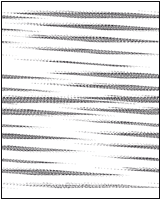 Wort mit allem Rechte veralten lassen, aber
dafr ist noch im gemeinen Leben das nicht viel bessere adje blich.Ò
Wort mit allem Rechte veralten lassen, aber
dafr ist noch im gemeinen Leben das nicht viel bessere adje blich.Ò
Andere Einschtzungen teilen wir noch
heute, z.B. da§ das Wort abtrn- nig
von dem ãlngst veraltetenÒ Haupt- wort Trunn
abstammt. Bei Wrtern wie dem schwierig zu
schreibenden Conter- ft sind wir froh, da§
es verschwunden bleibt. Ausgestorben sind bis heute z.B.
der Achseltrger
(ÒHeuchlerÒ), die Bunge
(mit vielen
Bedeutungen, z.B. Fischreu- se), butt ist uns nur mehr als Hauptwort der Butt bekannt (flacher
Fisch; ist von butt ãgrobÒ abgeleitet), dingflchtig (Òden Gerichten entflohenÒ), ehs (Òe§barÒ, bei Bckern), erfallen (Òzu Tode fallenÒ)
oder das Fenn (Òein sumpfiges Stck LandÒ, vgl. engl. fen). Manchmal ist nur ein Teil- gehalt des Wortes veraltet, z.B. bei der Golf die Bedeutung ãSchlundÒ, whrend die von ãMeerbusenÒ auch
heute noch gelufig ist. Andere sind z.T. in verschie- denen Gebieten noch gebruchlich, z.B. Bhel ãHgelÒ in oberdeutschen Mund- arten. Es erstaunt uns, da§ der (und die) Buhle schon damals veraltet waren. Be- suchern der
Salzburger Festspiele ist die Buhlschaft in
Hugo von Hoffmannsthals
ãJedermannÒ bekannt.
Wir sehen, da§ es jede Menge deut- schen Wortschatz gibt, der brachliegt und nur darauf wartet,
von uns wiederbelebt zu werden, anstatt da§ wir stets das Ame- rikanische
nachahmen und denglische Ausdrcke daraus
bilden. Vorbild sind uns die Islnder, die oft jahrelang
daran arbeiten, einen Ausdruck
aus ihrer Litera- tur fr eine neue Erscheinung zu finden. [gf WSB 3/06 ] n
Dr. Gottfried Fischer, Schriftleiter der Wiener
Sprachbltter , Zeitschrift fr gutes Deutsch. Her-
ausgeber: Verein ÒMutterspracheÓ Wien, gr§ter Sprachpflegeverein
sterreichs.
Goetz.Fischer@univie.ac.at
 der hochdeutschen MundartÒ in fnf Bn-
den, 1774-1786), auf dem oberschsischen
Sprachgebrauch aufbauend.
der hochdeutschen MundartÒ in fnf Bn-
den, 1774-1786), auf dem oberschsischen
Sprachgebrauch aufbauend.